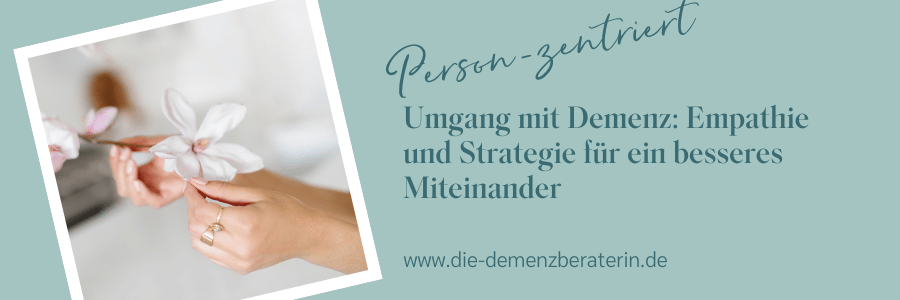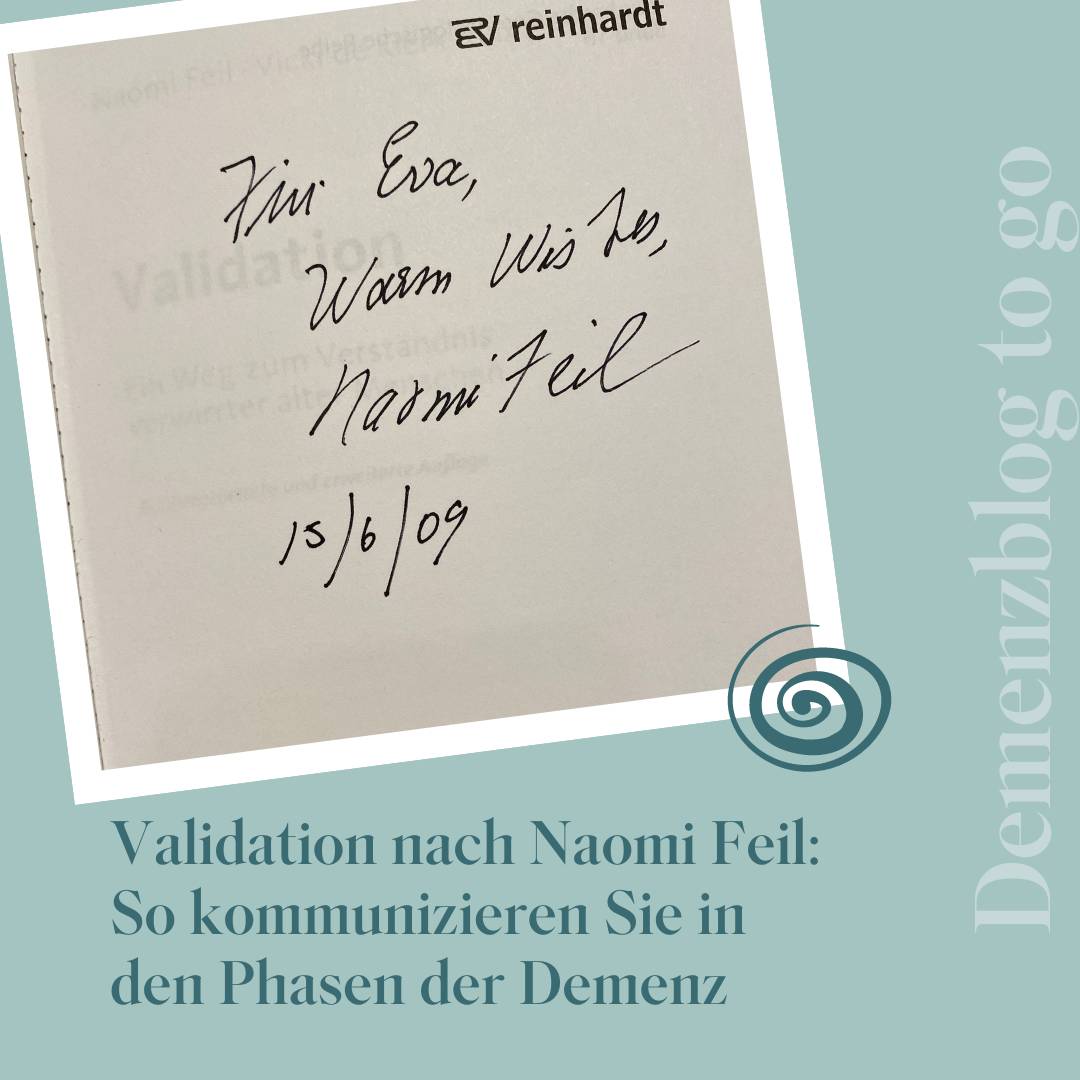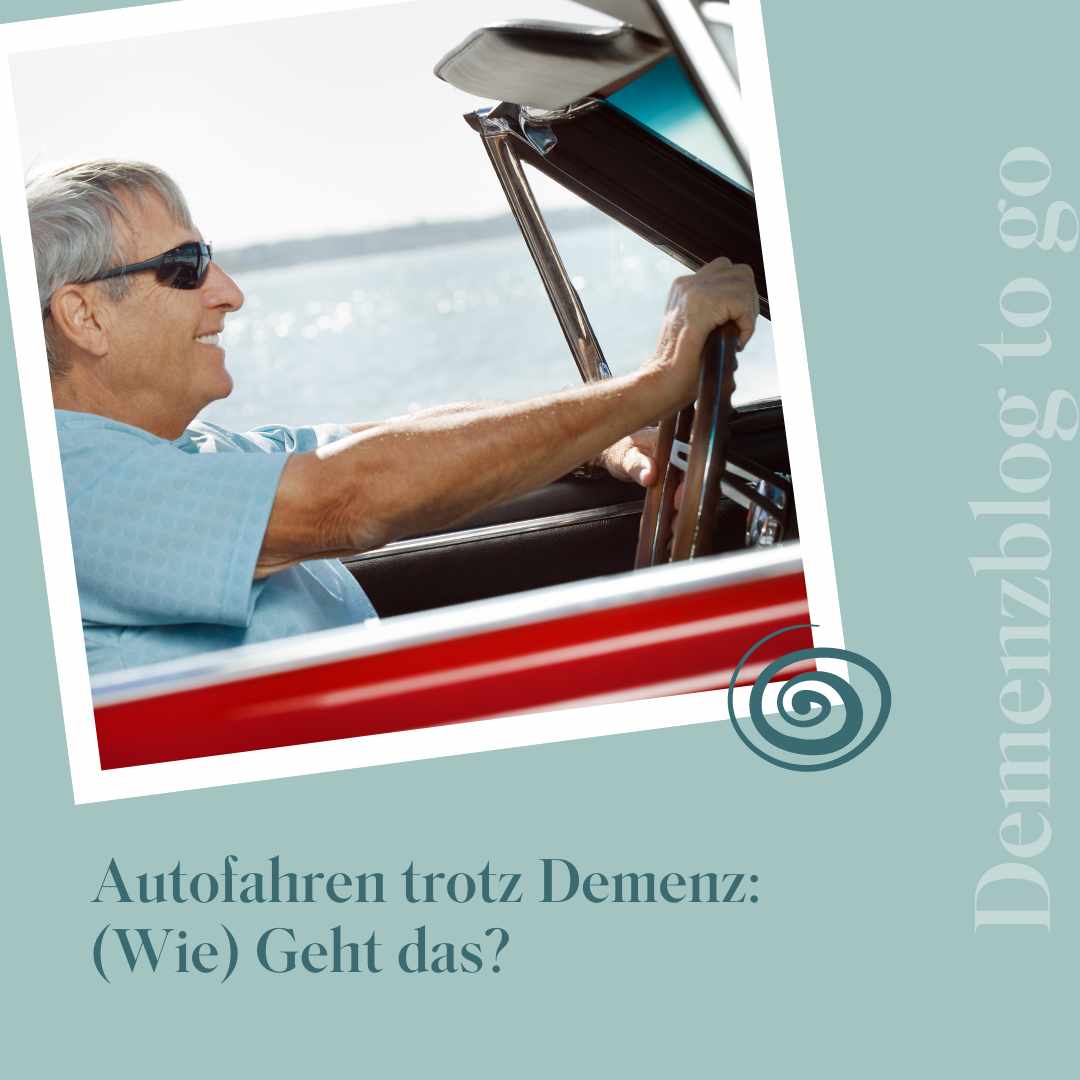„Die Demenzkranken werden alle aggressiv!“ Solche Sätze höre ich leider immer wieder. Doch das stimmt so nicht, denn die Art und Weise der Begleitung und der Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen tragen dazu bei, wie sich Ihre Beziehung gestaltet. Aggressiv oder nicht? Sie haben es selbst mit in der Hand.
Warum es wichtig ist, die Grundbedürfnisse von Menschen mit Demenz zu erkennen
So sah die Pflege im letzten Jahrhundert aus
Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Kriterien für gute Pflege „satt und sauber“ lauteten. Damals waren alte und verwirrte Menschen in Pflegeheimen in Vier- und Sechsbettzimmer untergebracht und starre Strukturen nahmen keine Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse der Pflegebedürftigen.
Und genau in dieser Zeit nahmen auch die ersten, damals noch revolutionären Methoden ihren Anfang. Die Amerikanerin Naomi Feil entwickelte das Konzept der Validation, Ute Schmidt-Hackenberg erfand in Deutschland die 10-Minuten-Aktivierung und der englische Sozialpsychologe Tom Kitwood (1937 – 1998) schuf den person-zentrierten Ansatz zum Umgang mit Menschen mit Demenz-Diagnose, der heute zum Expertenstandard des Umgangs mit Menschen mit Demenz gehört. Ich gebe zu, dass dies mein allerliebstes Lieblingskonzept im Umgang mit Menschen mit Demenz ist. Weil es einfach immer funktioniert.
Wie Pflegende problematisches Verhalten verursachten
Ausgangspunkt für die Arbeit Tom Kitwoods waren seine Beobachtungen des Umgangs mit demenzkranken Menschen bei seinen Besuchen im Pflegeheim. Dort sah man die an Alzheimer Erkrankten nicht als Menschen mit Angewohnheiten, Wünschen und Bedürfnissen sondern als Problemfälle und Objekte der Fürsorge.
Er erlebte, wie die Haltung und das Verhalten der Pflegekraft selbst schwierige Situationen auslösten. Und gleichzeitig erkannte Tom Kitwood, dass diese Beschäftigten es offenbar nicht besser wussten, dass ihnen sowohl die Fähigkeiten zur Analyse einer herausfordernden Situation fehlten als auch geeignete Handlungsalternativen.
Mit seinem einfachen Handlungsansatz, den er entwickelte, können Sie als Familienangehörige auch bei der Pflege und Betreuung zu Hause zu einem besseren Wohlbefinden für Ihren Angehörigen beitragen und sogar schwierige Situationen vorbeugend vermeiden.
Fünf Grundbedürfnisse für einen besseren Umgang mit Demenz
Mit der Theorie der Grundbedürfnisse schuf Tom Kitwood einen alltagspraktischen Ansatz, der zugleich als Werkzeug zur Vermeidung von herausforderndem Verhalten genutzt werden kann und der auch dort noch funktioniert, wo Verständnis und Geduld nicht ausreichen, um gut mit dem demenzkranken Angehörigen

Üblicherweise werden diese Grundbedürfnisse in Form einer stilisierten Blüte mit beschrifteten Blütenblättern dargestellt, der sogenannten Kitwood-Blume. Trost und Geborgenheit, Einbeziehung und Beschäftigung sowie der Wunsch nach einer Vertrauensperson sind normale menschlichen Bedürfnisse – doch je weiter die Erkrankung voranschreitet, um so weniger ist Ihr Angehöriger in der Lage, sich diese Bedürfnisse selbst zu erfüllen.
Trost und Geborgenheit
Hat Ihr Angehöriger eine Umgebung, die ihm liebevoll zugewandt ist? Es gibt viel zu trösten, wenn ein Mensch seine Erinnerungen verliert und wenn seine Fähigkeiten zur Selbstversorgung nachlassen. Und auch wenn durch die zeitliche Desorientierung schmerzhafte Erinnerungen zum Beispiel aus einer Kriegs- oder Vertreibungsbiografie wieder präsent werden. Wenn ich von problematischen Verhaltensweisen höre, frage ich fast immer zuerst danach, wann und wo die Person geboren ist. Nicht selten bekomme ich damit bereits erste Hinweise auf den Ursprung der unerwünschten Verhaltensweisen.
Frau Ernst (alle Namen sind natürlich wieder geändert) musste als 12jährige ihre sudetendeutsche Heimat verlassen. In der DDR, in der sie nach der Vertreibung lebte, wurde das durch die Vertreibung entstandene Unrecht totgeschwiegen. Erst durch die Demenz konnte der Verlust des Elternhauses und der Heimat von Frau Ernst betrauert werden. Was sie brauchte, wenn sie wieder und wieder vom verlorenen Elternhaus erzählte, waren Menschen, die ihren wiederholt erzählten Geschichten geduldig zuhörten und ihre Trauer anerkannten.
Erfahren Sie am Strategietag, wie Sie erkennen, ob das Bedürfnis nach Trost und Geborgenheit bei Ihrem Angehörigen erfüllt ist – und was Sie tun können, dieses Bedürfnis zu stärken.
Identität
Unsere Lebensgeschichte, wer wir als Kind, Jugendlicher, Erwachsenen waren und wer wir aktuell in Beziehung zu unseren Mitmenschen sind, prägt unsere Identität. Wenn Ihr Angehöriger durch sein schlechter werdendes Gedächtnis immer weniger Zugang zu seinen Erinnerungen hat, braucht er in seinem Umfeld viele Hinweise, die ihn wieder mit seiner eigenen Lebensgeschichte in Kontakt bringen.
In der professionellen Pflege wird das Biografie-Arbeit genannt. Dabei können es auch die ganz kleinen Gesten sein, die Ihren demenzkranken Angehörigen wieder an seine eigene Geschichte erinnern. Manchmal reicht ein „guten Morgen, Mama. Du siehst heute wieder so schick aus. Kein Wunder, du warst ja auch die beste Schneiderin der Stadt!“ Es hat keine Minute gedauert, Ihre Mutter – quasi nebenbei und ohne belehrend zu wirken – wieder mit ihrer Biografie in Kontakt zu bringen. Ich nenne es gerne meinen „Bienchenjob“ – die kurzen, persönlichen Worte, die keine Mühe machen. Natürlich verrate ich dazu auch mehr im Online Strategietag: Was tun bei Demenz?.
Einbeziehung
Gemeinschaft und Verbundenheit sind Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Sie haben sich bereits im Kindesalter herausgebildet haben. Die Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Gruppen gibt jedem Menschen Sicherheit. Leider erleben Menschen mit Demenz häufig, dass von anderen Menschen darüber entschieden wird, was gut für sie ist, ohne dass sie selbst dabei einbezogen wurden.
Frau Weismantel hatte als junge Frau, bis zur Enteignung in den 60er Jahren der DDR, den kleinen Betrieb ihrer Eltern geleitet. Im Pflegeheim fand sie zunächst keinen Zugang zu den anderen Bewohnerinnen des Wohnbereiches und auch den Pflegekräften gegenüber verhielt sie sich abweisend. Es zeigte sich, dass sie trotz ihrer schroffen Haltung unglücklich war. Durch eine bewusste Beziehungsgestaltung – indem die Wohnbereichsleiterin begann, Frau Weismantel immer wieder um ihren Rat zu fragen – erreichten wir eine langsame Besserung. „Wie viele Kuchen mögen wohl zum Sommerfest ausreichend sein?“ „Was kann wohl machen, wenn so viele Mitarbeiter*innen gleichzeitig in den Ferien Urlaub nehmen möchten?“ Frau Weismantel fühlte sich wertgeschätzt und fand sich immer besser in die Gruppe der Bewohnerinnen ein.
Ich höre schon, wie einige Leserinnen jetzt sagen: „Aber mein Angehöriger kann doch solche Entscheidungen gar nicht mehr treffen!“ Und damit mögen Sie recht haben. Und doch macht das Gefühl, in Entscheidungen einbezogen zu werden, für den Menschen mit Demenz den großen Unterschied!
Persönliche Bindung
Menschen mit Demenz erleben zunehmend Stress- und Belastungssituationen. Sie verstehen ihre innere und die sie umgebene äußere Welt nicht mehr und fühlen sich dadurch verloren. Alois Alzheimer nannte die Erkrankung zu Beginn seiner Forschung tatsächlich die „Krankheit der Verlorenheit“. Ihr erkrankter Angehöriger braucht jetzt eine Vertrauensperson, und in vielen Fällen werden Sie das sein. Damit ist eine ganz besondere Verantwortung verbunden, denn durch strategische „Notlügen“, wie sie manchmal gebraucht werden, verspielen Menschen (oft wohlmeinend) dieses vorbehaltlose Vertrauen.
Nicht immer ist es leicht, ehrlich zu bleiben – manchmal werden Sie unbequeme Diskussionen erleben, ein andermal würde die Wahrheit – zum Beispiel „Aber Oma ist doch schon lange tot!“ – den Menschen, der gerade eine Phase zeitlicher Desorientierung erlebt, sehr traurig machen. Dann sind Ihre diplomatischen Fähigkeiten gefragt. Deshalb werden wir am Strategietag auch auf eine einfache Form der Validation eingehen.
Frau Sonntag sehnte ich nach dem Besuch ihres Sohnes. Dem Einzug ins Pflegeheim stimmt sie zu, da er mit einem Umzug in den Wohnort des Sohnes verbunden war. Leider konnte der Sohn mit der fortschreitenden Demenz der Mutter nicht umgehen. Und obwohl die Schwiegertochter regelmäßig kam, blieb das Bedürfnis nach primärer Bindung unerfüllt.
Beschäftigung
Ich kriege stets die Krise, wenn ich sehe, was und wie in Einrichtungen mit den alten Menschen gebastelt wird. Da sitzen ehemalige Chefsekretärinnen, Maurermeister, Friseurinnen und Ingenieure mit der Betreuungskraft am Tisch und sollen mit einem Bügeleisen aus kleinen Plastikperlen Untersetzer basteln? Hilfe! Dabei ist jedoch mit dem Bedürfnis „Beschäftigung“ im person-zentrierten Konzept eine Tätigkeit gemeint, durch die sich der Mensch als wichtig und hilfreich für andere erlebt.
Eine alte Dame, die ihr Leben lang für Kinder und Enkel strickte, war unglücklich darüber, dass ihr nun gar nichts mehr glückte. Darauf brachten ihr die Pflegerinnen immer wieder halbfertige, misslungene Strickprojekte aus dem Bekanntenkreis mit, die die Frau sorgfältig auftrennte. Sie war zufrieden, nun wieder eine sinnvolle Aufgabe zu haben, der sie gewachsen war.
Wenn Sie nach einer sinnvollen Beschäftigung für Ihren Angehörigen suchen, dann überlegen Sie am besten, was er oder sie gern tut oder früher gern getan hat. Maßstab darf nun nicht mehr das perfekte Ergebnis sein, sondern das genussvolle Erlebnis des Tuns.

Das Geheimnis der Grundbedürfnisse
Ist eines der oben genannten Bedürfnisse nicht erfüllbar, so wie bei der Frau, deren Sohn nicht mehr zu Besuch kam, kann es zu herausfordernden Verhaltensweisen kommen. Die demenzkranke Person wird unruhig, verbal oder tätlich aggessiv oder zieht sich völlig zurück. Auch Lauftendenzen, ständiges Suchen und Kramen in Taschen und Schränken oder Rufen gehören zu den Verhaltensweisen.
Es bedarf einer guten Beobachtungsgabe herauszufinden, inwieweit ein Bedürfnis erfüllt ist oder unerfüllterweise zum Auslöser problematischer Verhaltensweisen wird. Dafür habe ich ein Arbeitsblatt entworfen, das wir am Strategietag nutzen werden.
All diese Grundbedürfnisse Ihres Angehörigen sind miteinander verwoben, manchmal auch schwer voneinander abgrenzbar (das macht nichts!) und bedingen sich gegenseitig. Genau diese Tatsache macht den person-zentrierten Ansatz so wertvoll. Denn es scheint, als ob die Unerfüllbarkeit eines Bedürfnisses durch ein Mehr bei den anderen Bedürfnissen kompensiert werden könne.
Die Umsetzung im Alltag in der Familie wird erleichtert durch eine ganze Reihe von konkreten Handlungs-Optionen. Für alle, die Lust haben, solche Verbesserungen am Strategietag auszuprobieren, geht es hier zur Buchung.